O S T A F R I K A
Zwischen den Extremen
Ostafrika in Zeiten von El Niño -
eine Reportage von Jannis Carmesin
eine Reportage von Jannis Carmesin
Das östliche Afrika erlebt in diesen Monaten eine Zeit der klimatischen Extreme: Während das Klimaphänomen
El Niño in manchen Regionen so viel Regen bringt wie seit 20 Jahren nicht, raffen andernorts Dürren die letzten Ziegen und Kamele der Viehzüchter dahin.
Wie Betroffene und Hilfsorganisationen darauf reagieren: zwei Geschichten aus Somaliland und Kenia
_______________________
El Niño in manchen Regionen so viel Regen bringt wie seit 20 Jahren nicht, raffen andernorts Dürren die letzten Ziegen und Kamele der Viehzüchter dahin.
Wie Betroffene und Hilfsorganisationen darauf reagieren: zwei Geschichten aus Somaliland und Kenia
_______________________
K L I M A F L U C H T
Wüstenläufer
SOMALILAND | Eine anhaltende Dürre in Teilen von Somaliland zwingt tausende Viehnomaden dazu, das traditionelle Leben aufzugeben und sich in den Dörfern und Städten niederzulassen. Diese ächzen unter der Last der Neuankömmlinge - und versuchen, ihnen gemeinsam mit internationalen Organisationen alternative Lebensmodelle anzubieten.
Bis 2050, berichtete UN-Generalsekretär Ban Ki-moon 2009 vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York, werde es weltweit mehrere Millionen Klimaflüchtlinge geben. Wahre Völkerwanderungen, verursacht von den globalen klimatischen Veränderungen.
Saada Hashi hat sich schon auf den Weg gemacht. Gut 10.600 Kilometer entfernt von New York sitzt sie im Januar 2016 auf einem bierkastengroßen Felsbrocken vor ihrem Haus, das eigentlich nur ein großes Zelt ist. Ein paar schiefe Äste in schneeweißem Sand, bedeckt mit Lumpen und Grasmatten. Saada Hashi, 47 Jahre alt, eine tiefe Falte zwischen den Augen, lebt erst seit ein paar Wochen mit ihrer Familie hier in Lughaya. Ein Städtchen an der Küste Somalilands, dessen 2500 Haushalte sich so weit in der toten Wüstenlandschaft verteilen, dass Lughaya eher wirkt wie eine lose Ansammlung ärmlicher Siedlungen.
Saada Hashi hat sich schon auf den Weg gemacht. Gut 10.600 Kilometer entfernt von New York sitzt sie im Januar 2016 auf einem bierkastengroßen Felsbrocken vor ihrem Haus, das eigentlich nur ein großes Zelt ist. Ein paar schiefe Äste in schneeweißem Sand, bedeckt mit Lumpen und Grasmatten. Saada Hashi, 47 Jahre alt, eine tiefe Falte zwischen den Augen, lebt erst seit ein paar Wochen mit ihrer Familie hier in Lughaya. Ein Städtchen an der Küste Somalilands, dessen 2500 Haushalte sich so weit in der toten Wüstenlandschaft verteilen, dass Lughaya eher wirkt wie eine lose Ansammlung ärmlicher Siedlungen.
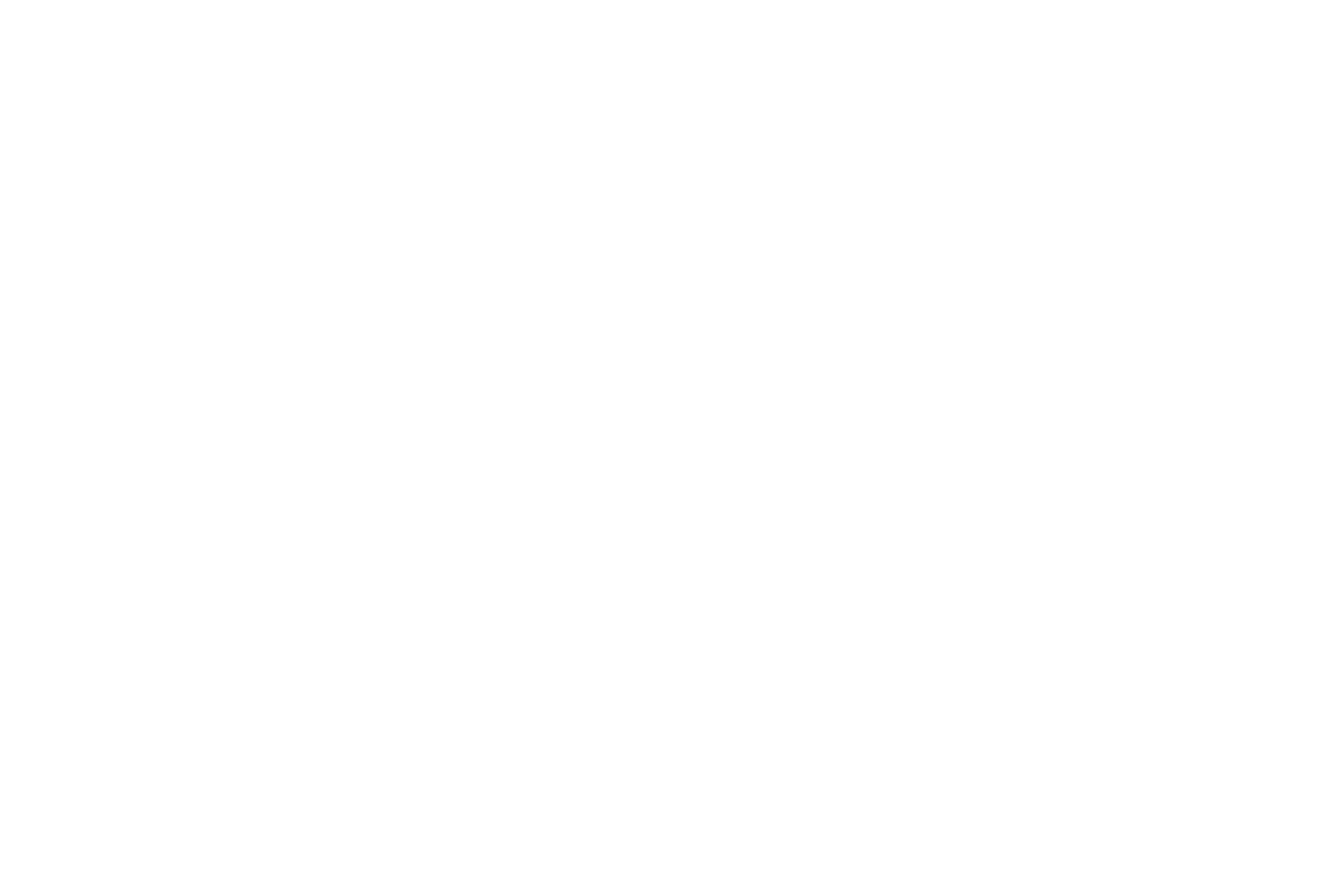
Saada Hashi sitzt, umgeben von ihren Kindern, vor ihrer Hütte im Dörfchen Lughaya. Hier hat die Familie sich vor wenigen Wochen niedergelassen.
Seitdem Saada Hashi denken kann, war sie mit ihrer Familie auf Wanderschaft. Gemeinsam mit ihrem Mann und den fünf Kindern zog sie als Viehnomadin Jahr für Jahr hunderte Kilometer durch die Ceelahelay-Region, etwa einen Tagesmarsch entfernt von Lughaya, immer dorthin, wo es noch grünte. Schließlich musste das Vieh zu fressen bekommen, das in Somaliland kein reines Besitztum ist, sondern unerlässlich, um ein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft zu sein.
100 Ziegen und 20 Kamele hatte die Familie. Das bedeutete keinen großen Reichtum, war aber genug für ein solides Leben in einer der kleinsten Volkswirtschaften der Welt. „Es ging uns gut", erzählt sie. „Wir hatten immer frische Milch, Fleisch aus der eigenen Schlachtung und ein bisschen Geld, wenn wir etwas davon auf dem Markt losgeworden sind."
100 Ziegen und 20 Kamele hatte die Familie. Das bedeutete keinen großen Reichtum, war aber genug für ein solides Leben in einer der kleinsten Volkswirtschaften der Welt. „Es ging uns gut", erzählt sie. „Wir hatten immer frische Milch, Fleisch aus der eigenen Schlachtung und ein bisschen Geld, wenn wir etwas davon auf dem Markt losgeworden sind."
Doch dann blieb der Regen immer häufiger aus – drei Jahre lang habe es praktisch nicht geregnet, erzählen die Menschen hier in Lughaya. Irgendwann hatten die Ziegen die letzten Grashalme aus dem Boden und die letzten Blätter von den Akazien-Bäumen gezupft. Saada Hashis Vieh begann zu sterben, ein Tier nach dem anderen, bis nur noch die zehn Ziegen übrig waren, die sie heute ihre letzten Besitztümer nennt. In letzter Not zog die Familie nach Lughaya und ließ sich im Schutz der Siedlung nieder, um Unterstützung zu finden. Entscheidend gebessert hat sich ihr Leben hier bislang nicht. „Es fehlt an allem", erzählt Hashi. „In den vergangenen Wochen hatten wir meistens nur trockenen Reis, manchmal auch überhaupt nichts zu essen."
Die Trockenheit treibt die Viehnomaden in die Dörfer und Städte
Somaliland, die seit 1991 unabhängige aber international nach wie vor nicht anerkannte somalische Teilrepublik, verändert sich in diesen Jahren tiefgreifend. Zwar ist die Region verglichen mit dem Rest von Somalia friedlich, doch die extremen klimatischen Bedingungen wirbeln ähnlich wie im Nachbarland Äthiopien die alten Verhältnisse durcheinander. Über 80.000 IDPs, „Internally Displaced Persons", wie die Binnenvertriebenen im sperrigen NGO-Sprech genannt werden, zählte das Genfer Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) hier im vergangenen Jahr.
Die meisten sind Viehzüchter wie Saada Hashi und ihre Familie, die die traditionelle nomadische Lebensweise aufgegeben haben und vor der Dürre in die Städte und Dörfer flüchten. Diese treiben wie letzte Rettungsinseln in der toten Wüste, weil internationale Hilfsorganisationen hier zumindest einfache Lebensmittel verteilen und Krankenstationen betreiben, während draußen in der Einöde Ziegenkadaver am Straßenrand verwesen.
Die Trockenheit treibt die Viehnomaden in die Dörfer und Städte
Somaliland, die seit 1991 unabhängige aber international nach wie vor nicht anerkannte somalische Teilrepublik, verändert sich in diesen Jahren tiefgreifend. Zwar ist die Region verglichen mit dem Rest von Somalia friedlich, doch die extremen klimatischen Bedingungen wirbeln ähnlich wie im Nachbarland Äthiopien die alten Verhältnisse durcheinander. Über 80.000 IDPs, „Internally Displaced Persons", wie die Binnenvertriebenen im sperrigen NGO-Sprech genannt werden, zählte das Genfer Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) hier im vergangenen Jahr.
Die meisten sind Viehzüchter wie Saada Hashi und ihre Familie, die die traditionelle nomadische Lebensweise aufgegeben haben und vor der Dürre in die Städte und Dörfer flüchten. Diese treiben wie letzte Rettungsinseln in der toten Wüste, weil internationale Hilfsorganisationen hier zumindest einfache Lebensmittel verteilen und Krankenstationen betreiben, während draußen in der Einöde Ziegenkadaver am Straßenrand verwesen.
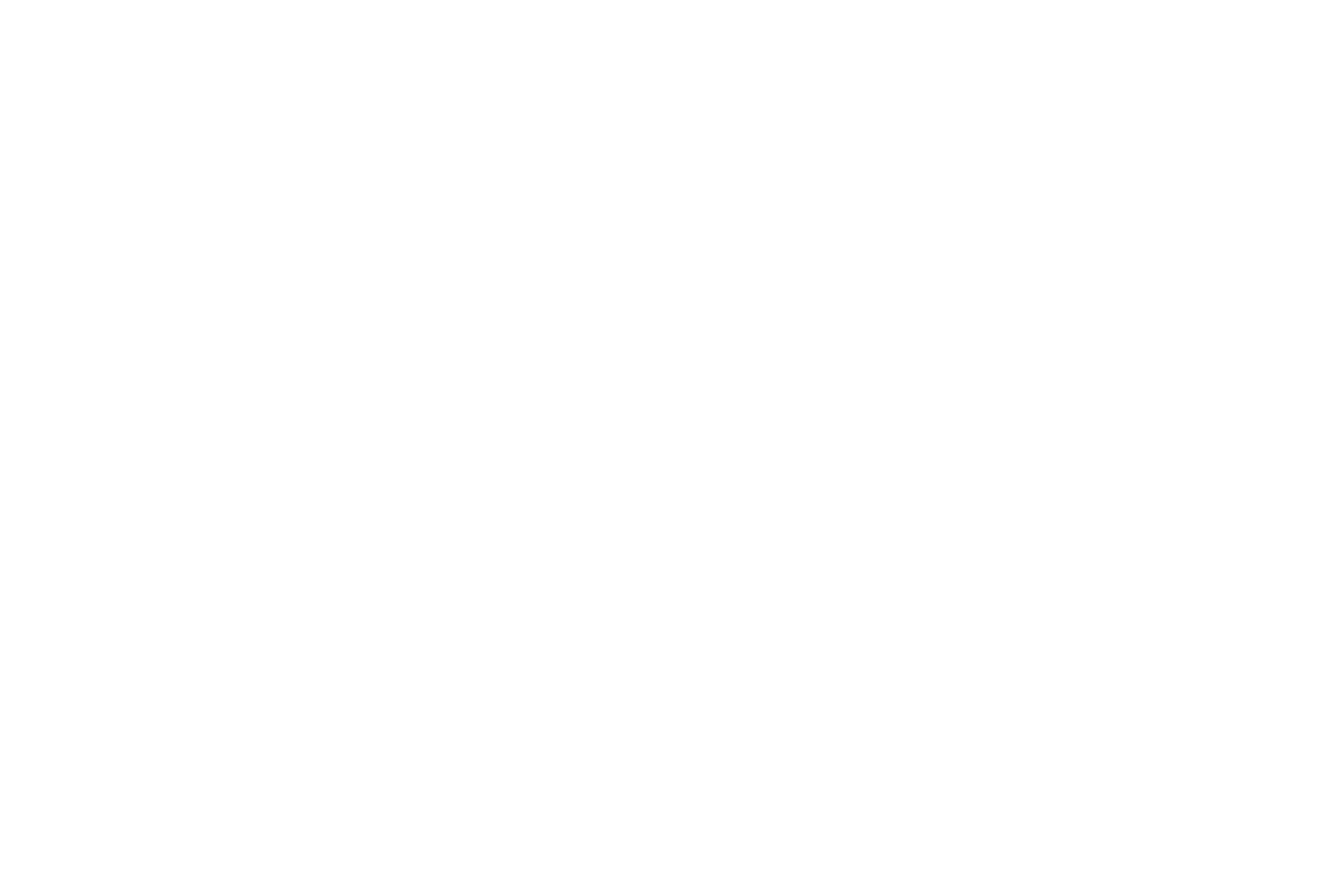 | 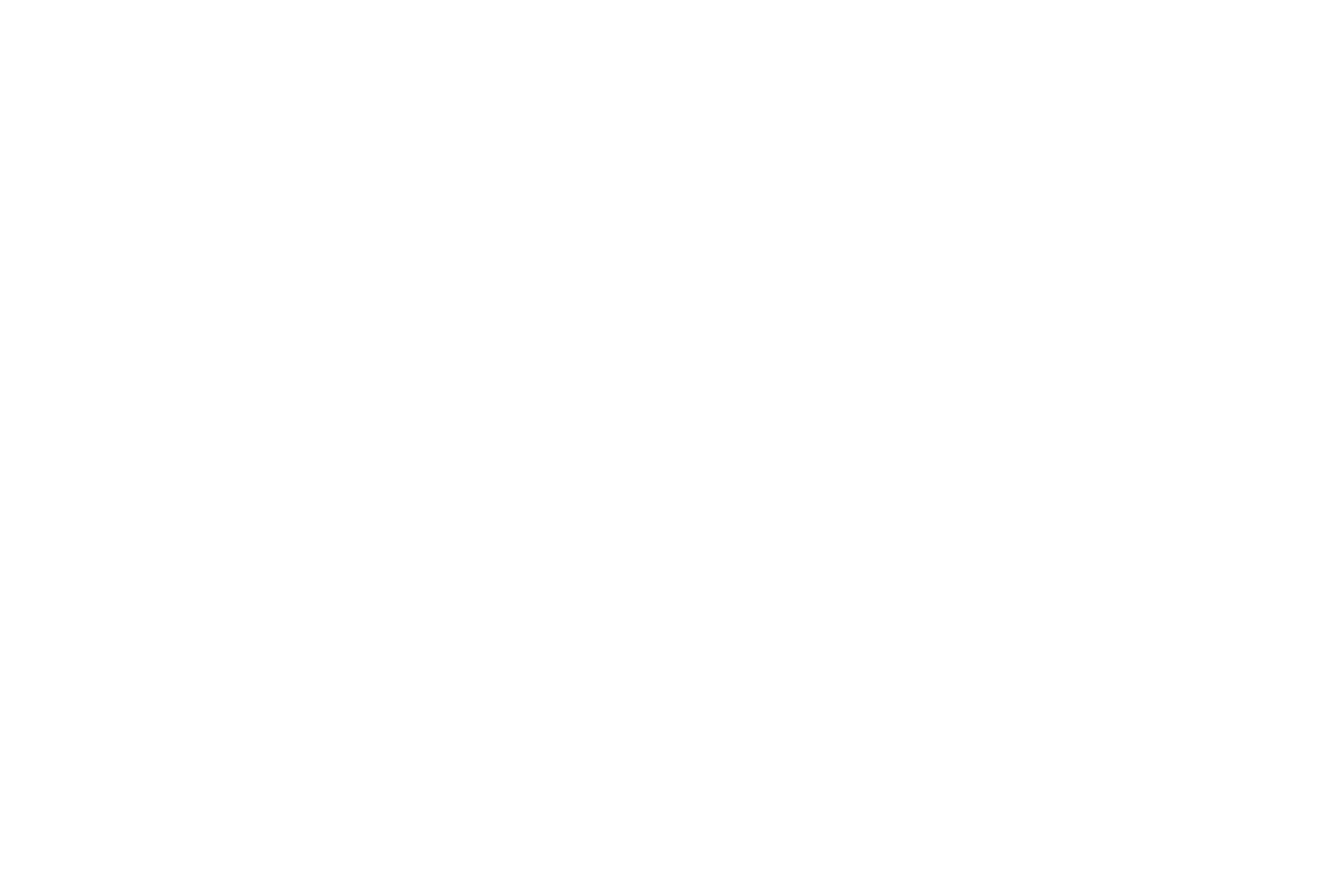 | 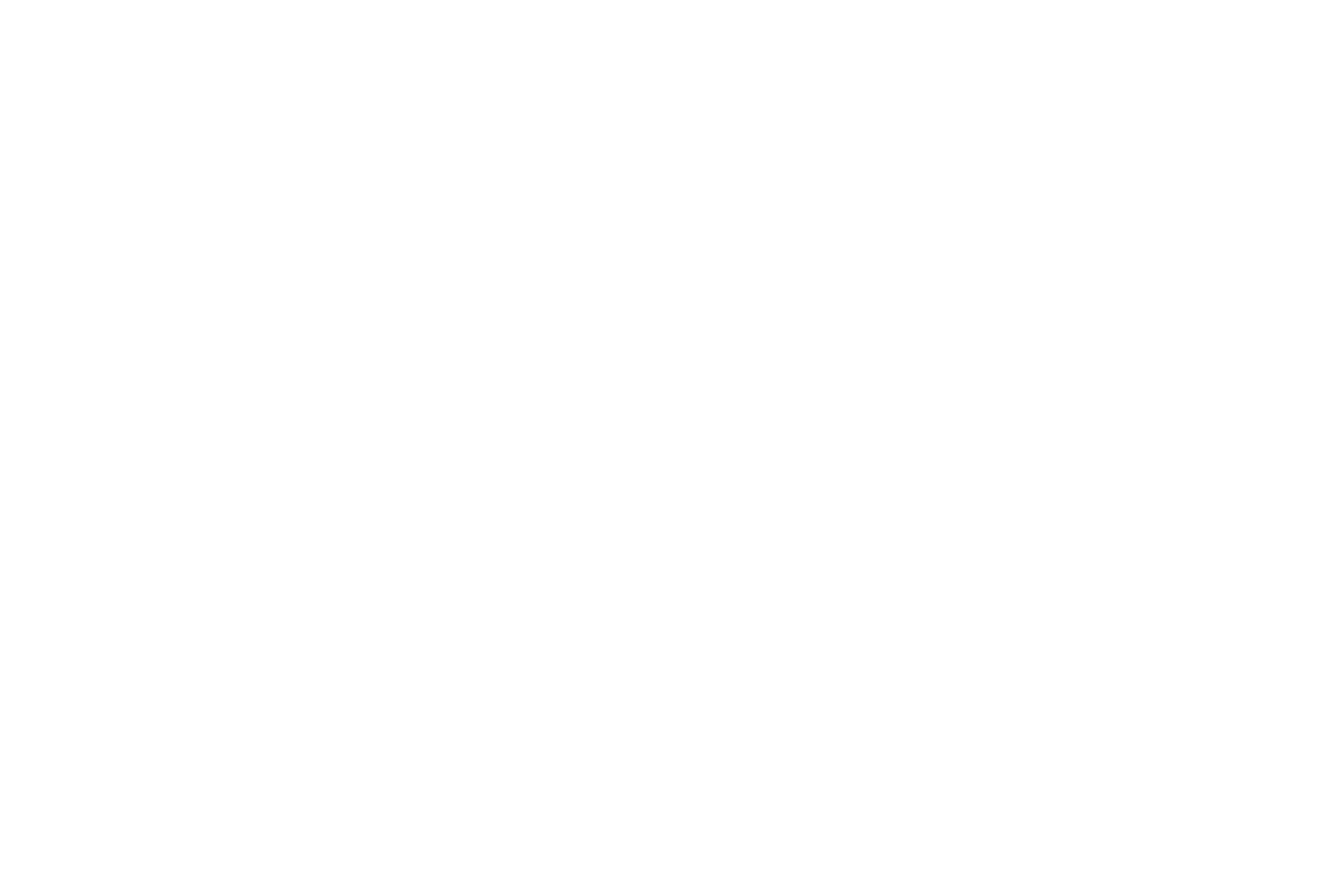 |
Die Gemeinden, in denen ohnehin schon viele Menschen am Existenzminimum leben, treibt die Entwicklung ans Limit. „Ohne internationale Hilfe würden hier nicht mehr nur Tiere, sondern auch Menschen sterben", sagt Eige Ali Hussein, 54 Jahre alt, stellvertretender Bürgermeister von Lughaya. Auf seinen Gehstock gestützt sitzt er im Hof der kleinen Krankenstation und erzählt, wie rasant sich die Gegend in den vergangen Jahren verändert hat: Während zwischen 2012 und 2014 insgesamt 250 Menschen nach Lughaya gekommen seien, waren es 2015 laut Hussein allein 500. In anderen Ortschaften im Landesinneren machen die Binnenflüchtlinge bereits mehr als die Hälfte der Dorfbevölkerung aus. Das sind grobe Schätzungen in einem Land, dessen Autoritäten andere Probleme haben als präzise Statistiken zu führen, aber sie geben doch eine deutliche Tendenz wieder.
Soziale Konflikte zwischen sesshafter und zugezogener Bevölkerung seien zumindest in seinem Dorf bisher ausgeblieben, sagt Hussein, weil es Teil der krisengeplagten somalischen Mentalität sei, das bisschen was man habe zu teilen. Auf Dauer, wenn das Leid größer und der Zustrom stärker werden sollte, könne das aber keiner garantieren.
Fortbildungen und Start-Up-Förderung statt "restocking"
Angesichts dieser Entwicklung wächst die Abhängigkeit Somalilands von internationalen Organisationen. Sie halten nicht nur die Grundversorgung an Nahrungsmitteln und das komplette Gesundheitssystem am Laufen, sondern unterstützen gezielt auch Klimaflüchtlinge, indem sie deren dezimierte Viehbestände mit gesunden Tieren aufstocken. Für die Betroffenen sind diese sogenannten „restocking"-Programme genau wie die Notversorgung durch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen überlebensnotwendig. Nachhaltig sind sie angesichts der Prognosen, die immer länger werdende Dürreperioden voraussagen, aber nicht. Schließlich weiß keiner, wie lange das neue Vieh bei anhaltender klimatischer Entwicklung überleben wird.
Die Strategie der kommunalen Politik und internationalen NGOs hat sich deshalb in den vergangenen Jahren verändert: Viehzüchter sollen dazu gebracht werden, alternative Lebensmodelle zu erwägen. Eige Ali Hussein schlägt etwa vor, den Viehzüchtern Boote für den Fischfang bereitzustellen oder Startkapital für den Aufbau kleiner Ladengeschäfte anzubieten. „Es geht darum, dass die IDPs sich breiter aufstellen und sich Möglichkeiten schaffen, flexibler auf Dürren reagieren zu können als bislang", sagt auch Anne Hölscher von World Vision, eine der in Somaliland aktiven NGOs.
VIDEO: Im Dörfchen Garbodadar führen fünf ehemalige Viehnomadinnen einen kleinen Laden.
Soziale Konflikte zwischen sesshafter und zugezogener Bevölkerung seien zumindest in seinem Dorf bisher ausgeblieben, sagt Hussein, weil es Teil der krisengeplagten somalischen Mentalität sei, das bisschen was man habe zu teilen. Auf Dauer, wenn das Leid größer und der Zustrom stärker werden sollte, könne das aber keiner garantieren.
Fortbildungen und Start-Up-Förderung statt "restocking"
Angesichts dieser Entwicklung wächst die Abhängigkeit Somalilands von internationalen Organisationen. Sie halten nicht nur die Grundversorgung an Nahrungsmitteln und das komplette Gesundheitssystem am Laufen, sondern unterstützen gezielt auch Klimaflüchtlinge, indem sie deren dezimierte Viehbestände mit gesunden Tieren aufstocken. Für die Betroffenen sind diese sogenannten „restocking"-Programme genau wie die Notversorgung durch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen überlebensnotwendig. Nachhaltig sind sie angesichts der Prognosen, die immer länger werdende Dürreperioden voraussagen, aber nicht. Schließlich weiß keiner, wie lange das neue Vieh bei anhaltender klimatischer Entwicklung überleben wird.
Die Strategie der kommunalen Politik und internationalen NGOs hat sich deshalb in den vergangenen Jahren verändert: Viehzüchter sollen dazu gebracht werden, alternative Lebensmodelle zu erwägen. Eige Ali Hussein schlägt etwa vor, den Viehzüchtern Boote für den Fischfang bereitzustellen oder Startkapital für den Aufbau kleiner Ladengeschäfte anzubieten. „Es geht darum, dass die IDPs sich breiter aufstellen und sich Möglichkeiten schaffen, flexibler auf Dürren reagieren zu können als bislang", sagt auch Anne Hölscher von World Vision, eine der in Somaliland aktiven NGOs.
VIDEO: Im Dörfchen Garbodadar führen fünf ehemalige Viehnomadinnen einen kleinen Laden.
Gute zwei Autostunden entfernt im Landesinneren liegt an einer Sandpiste, die in Somaliland schon fast als Highway durchgeht, das Dörfchen Garbodadar, 1450 Haushalte, gut 60 Prozent davon zugezogene IDPs.
Ein paar hundert Meter hinter der Ortschaft durchzieht im Schatten einer Gebirgskette ein Zaun die karge Landschaft. Das 500 Quadratmeter große eingezäunte Gelände ist ein Versuch, gegen die Entwaldung der Gegend vorzugehen, in der nur ein paar hartnäckige Akazien-Bäume und massenweise Prosopis Juliflora (ein enorm dürreresistenter aber für das Ökosystem nutzloser Strauch) überlebt haben. So soll - gefördert vom deutschen Bundesministerium für Entwicklung und Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) - ein Lebensraum entstehen, in dem Landwirtschaft und Viehzucht möglich werden.
FMNR soll die Landschaft wiederbeleben
Das Areal ist ein „Farmer Managed Natural Regeneration Project", wie es auf einem Schild kurz vor dem braunen Maschendrahtzaun geschrieben steht. Farmer Managed Natural Regeneration, kurz FMNR, wurde in den 80er Jahren vom australischen Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo entwickelt und soll die Landschaft rund um Garbodadar wiederbeleben. Rinaudo sagt, man habe mit der Methode schon einige Millionen Hektar Fläche in verschiedenen afrikanischen Ländern begrünt, in Niger gar die Hälfte des kompletten Ackerlandes.
Während Wissenschaftler seit Jahrzehnten unter hohem Aufwand an Formeln für die optimale Kombination und Anordnung verschiedener Pflanzen beim konventionellen Waldfeldbau in Wüstenregionen tüfteln, setzt Rinaudo auf die Regeneration der natürlicherweise in der Gegend vorhandenen Baumarten. „Jede einzelne Art wächst nur deshalb, weil sie in genau dieser ökologischen Nische am besten gedeihen und bestehende Beschränkungen überwinden kann", sagt der Agrarwissenschaftler. In vielen scheinbar toten Baumstümpfen, selbst im trockenen Sandboden, so glaubt er, schlummert noch Leben, das wieder erwachen könnte, wenn man ihm durch die Einhaltung ein paar einfacher Regeln die Chance dazu gibt.
Ein paar hundert Meter hinter der Ortschaft durchzieht im Schatten einer Gebirgskette ein Zaun die karge Landschaft. Das 500 Quadratmeter große eingezäunte Gelände ist ein Versuch, gegen die Entwaldung der Gegend vorzugehen, in der nur ein paar hartnäckige Akazien-Bäume und massenweise Prosopis Juliflora (ein enorm dürreresistenter aber für das Ökosystem nutzloser Strauch) überlebt haben. So soll - gefördert vom deutschen Bundesministerium für Entwicklung und Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) - ein Lebensraum entstehen, in dem Landwirtschaft und Viehzucht möglich werden.
FMNR soll die Landschaft wiederbeleben
Das Areal ist ein „Farmer Managed Natural Regeneration Project", wie es auf einem Schild kurz vor dem braunen Maschendrahtzaun geschrieben steht. Farmer Managed Natural Regeneration, kurz FMNR, wurde in den 80er Jahren vom australischen Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo entwickelt und soll die Landschaft rund um Garbodadar wiederbeleben. Rinaudo sagt, man habe mit der Methode schon einige Millionen Hektar Fläche in verschiedenen afrikanischen Ländern begrünt, in Niger gar die Hälfte des kompletten Ackerlandes.
Während Wissenschaftler seit Jahrzehnten unter hohem Aufwand an Formeln für die optimale Kombination und Anordnung verschiedener Pflanzen beim konventionellen Waldfeldbau in Wüstenregionen tüfteln, setzt Rinaudo auf die Regeneration der natürlicherweise in der Gegend vorhandenen Baumarten. „Jede einzelne Art wächst nur deshalb, weil sie in genau dieser ökologischen Nische am besten gedeihen und bestehende Beschränkungen überwinden kann", sagt der Agrarwissenschaftler. In vielen scheinbar toten Baumstümpfen, selbst im trockenen Sandboden, so glaubt er, schlummert noch Leben, das wieder erwachen könnte, wenn man ihm durch die Einhaltung ein paar einfacher Regeln die Chance dazu gibt.
In vielen scheinbar toten Baumstümpfen, selbst im trockenen Sandboden, glaubt Tony Rinaudo, schlummert noch Leben.
Die Kernpunkte von FMNR: Vieh ist im Areal komplett verboten, weil die Tiere aufkeimende Triebe von Bäumen und Sträuchern bei der Nahrungssuche aus dem Boden reißen würden. Die Dorfbewohner dürfen bei der Suche nach Feuerholz nur noch abgefallene Äste sammeln und die kleinen Triebe am unteren Ende des Stammes abschneiden. So sollen die stärksten Triebe der Pflanzen geschützt und das Baumwachstum gefördert werden. Verstöße werden von einem Rat, in dem jedes der umliegenden Dörfer einen Vertreter stellt, mit Geldstrafen geahndet. Das Ziel: die Regeneration des Ökosystems und ein kühleres, feuchteres Mikroklima.
Aus vom Klimawandel Betroffenen sollen durch FMNR Helfer im Kampf gegen eben diesen werden. „Den wenigsten der Viehnomaden ist bewusst, dass ihr Lebensstil einen entscheidenden Anteil an der voranschreitenden Desertifikation ihrer Heimat hat", sagt Anne Hölscher von der NGO World Vision, die das Projekt im Auftrag des BMZ betreut. Man habe den Menschen erst vermitteln müssen, dass die Pflanzen, die sie immer als Feuerholz und Futter benutzt hatten, als Schattenspender und Schutz vor Wind und Staub, als Sauerstoff- und Düngerproduzenten, auf lange Sicht einen größeren Wert hätten, wenn sie sie nur wachsen ließen. FMNR ist nicht nur eine Wiederaufforstungs-, sondern auch eine Erziehungsmaßnahme.
Kaum unabhängige Forschung
Das FMNR-Areal bei Garbodadar ist nicht das überzeugendste Beispiel für das Potenzial der Methode. Noch immer wirkt die Gegend äußerst karg, nur wenig Grün mischt sich in die öden Sandtöne der Wüstenlandschaft. Und weil es kaum wissenschaftliche Studien zur FMNR-Methode gibt, die ohne Beteiligung des Erfinders Rinaudo oder finanzielle Unterstützung durch World Vision entstanden sind, ist für Außenstehende kaum zu bewerten, wie effektiv die Maßnahmen tatsächlich sind. Vertreter von World Vision sagen, in einer so trockenen Gegend würden Erfolge nun einmal weniger schnell sichtbar. Man müsse da auf Kleinigkeiten achten, zum Beispiel Ameisen und Schmetterlinge als Vorboten einer Regeneration des Ökosystems. Und die seien da. "Wir sind zufrieden", sagt Anne Hölscher.
Auch Dorfbewohnerin Amina Dahir Alamagan, Mitte Fünfzig, in buntes Tuch gehüllt, sagt, das Projekt laufe ziemlich gut. Sie kniet ein Stück hinter dem Grenzzaun auf dem sandigen Boden und sammelt Feuerholz für den Abend. „Man kann schon eine Veränderung sehen", erzählt sie. „Es ist grüner geworden, da sind mehr Bäume, weil wir die vorhandenen schützen und gleichzeitig vor unseren Häusern neue gepflanzt haben."
Dann nimmt sie die trockenen Äste unter den Arm und stapft zurück in Richtung Dorf, um vor ihrer Hütte das Abendessen zu kochen. Während sie das Holz in ein kleines Stövchen legt und es dann anzündet, erzählt sie ihre Geschichte im Schnelldurchlauf: 150 Ziegen, 80 Kamele, die Dürre von 2011, die Flucht nach Garbodadar. Seitdem lebt sie hier als IDP, mit ihrem Ehemann, ein paar Ziegen und den sieben Kindern. „Es geht uns hier ganz gut", sagt sie. In ihr altes Nomadenleben zurück zu kehren, ist für sie keine Option. Die Familie Alamagan wird bleiben.
Aus vom Klimawandel Betroffenen sollen durch FMNR Helfer im Kampf gegen eben diesen werden. „Den wenigsten der Viehnomaden ist bewusst, dass ihr Lebensstil einen entscheidenden Anteil an der voranschreitenden Desertifikation ihrer Heimat hat", sagt Anne Hölscher von der NGO World Vision, die das Projekt im Auftrag des BMZ betreut. Man habe den Menschen erst vermitteln müssen, dass die Pflanzen, die sie immer als Feuerholz und Futter benutzt hatten, als Schattenspender und Schutz vor Wind und Staub, als Sauerstoff- und Düngerproduzenten, auf lange Sicht einen größeren Wert hätten, wenn sie sie nur wachsen ließen. FMNR ist nicht nur eine Wiederaufforstungs-, sondern auch eine Erziehungsmaßnahme.
Kaum unabhängige Forschung
Das FMNR-Areal bei Garbodadar ist nicht das überzeugendste Beispiel für das Potenzial der Methode. Noch immer wirkt die Gegend äußerst karg, nur wenig Grün mischt sich in die öden Sandtöne der Wüstenlandschaft. Und weil es kaum wissenschaftliche Studien zur FMNR-Methode gibt, die ohne Beteiligung des Erfinders Rinaudo oder finanzielle Unterstützung durch World Vision entstanden sind, ist für Außenstehende kaum zu bewerten, wie effektiv die Maßnahmen tatsächlich sind. Vertreter von World Vision sagen, in einer so trockenen Gegend würden Erfolge nun einmal weniger schnell sichtbar. Man müsse da auf Kleinigkeiten achten, zum Beispiel Ameisen und Schmetterlinge als Vorboten einer Regeneration des Ökosystems. Und die seien da. "Wir sind zufrieden", sagt Anne Hölscher.
Auch Dorfbewohnerin Amina Dahir Alamagan, Mitte Fünfzig, in buntes Tuch gehüllt, sagt, das Projekt laufe ziemlich gut. Sie kniet ein Stück hinter dem Grenzzaun auf dem sandigen Boden und sammelt Feuerholz für den Abend. „Man kann schon eine Veränderung sehen", erzählt sie. „Es ist grüner geworden, da sind mehr Bäume, weil wir die vorhandenen schützen und gleichzeitig vor unseren Häusern neue gepflanzt haben."
Dann nimmt sie die trockenen Äste unter den Arm und stapft zurück in Richtung Dorf, um vor ihrer Hütte das Abendessen zu kochen. Während sie das Holz in ein kleines Stövchen legt und es dann anzündet, erzählt sie ihre Geschichte im Schnelldurchlauf: 150 Ziegen, 80 Kamele, die Dürre von 2011, die Flucht nach Garbodadar. Seitdem lebt sie hier als IDP, mit ihrem Ehemann, ein paar Ziegen und den sieben Kindern. „Es geht uns hier ganz gut", sagt sie. In ihr altes Nomadenleben zurück zu kehren, ist für sie keine Option. Die Familie Alamagan wird bleiben.
D Ü R R E P R Ä V E N T I O N
Regensammler
KENIA | In Zentralkenia bringt El Niño so viel Regen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Um für künftige Dürren gewappnet zu sein, müssen die Farmer das wertvolle Wasser sammeln - und setzen dabei auf jahrhundertealte Methoden.
Die meisten Vierjährigen, erzählten sich die Menschen im kenianischen County Makueni eine Zeit lang gerne, hätten noch nie eine Maisstaude in den Himmel wachsen sehen. Dann begannen sie lauthals zu lachen und sich diesen Staub von Händen und Kleidern zu klopfen, der sich längst in jeden Winkel ihres Lebens gelegt hatte.
Es war Galgenhumor ostafrikanischer Ausprägung, denn der Spaß hatte einen ernsten Kern.
Tatsächlich wollte der Mais nicht so recht wachsen – und die Bohnen auch nicht – weil es fast das ganze Jahr über an Wasser mangelte. Und wenn dann endlich die lang ersehnte Regenzeit kam, die wenigstens ein, zwei Wochen Regen versprach, dann prasselte es so stark auf den ausgedorrten Boden, dass dieser das Wasser nicht aufnahm, sondern zu einer unberechenbaren Schlammlawine wurde.
"Das war die schlimmste Zeit", erinnert sich Joshua Motua, Farmer, Mitte 50, einer der mit der Trockenheit aufgewachsen und alt geworden ist. „Die Leute hier haben sich viel gestritten, alle waren angespannt, weil keine der Familien genug Wasser zur Verfügung hatte." Die Reserven aus der kurzen Regenzeit im Frühjahr reichten bis Juni oder Juli, danach begann Jahr für Jahr eine harte Zeit. Zuerst trocknete der kleine Fluss aus, der die Häuser der Bauern umfließt, irgendwann dann auch der andere, zwei Kilometer entfernt, der jahrelang als Notreserve hergehalten hatte. Auf der Suche nach der raren Ressource zogen die Menschen mit ihren gelben Kanistern durch die Gegend. „Da gab es kein soziales Leben mehr, kein Miteinander", sagt Joshua Motua.
Es war Galgenhumor ostafrikanischer Ausprägung, denn der Spaß hatte einen ernsten Kern.
Tatsächlich wollte der Mais nicht so recht wachsen – und die Bohnen auch nicht – weil es fast das ganze Jahr über an Wasser mangelte. Und wenn dann endlich die lang ersehnte Regenzeit kam, die wenigstens ein, zwei Wochen Regen versprach, dann prasselte es so stark auf den ausgedorrten Boden, dass dieser das Wasser nicht aufnahm, sondern zu einer unberechenbaren Schlammlawine wurde.
"Das war die schlimmste Zeit", erinnert sich Joshua Motua, Farmer, Mitte 50, einer der mit der Trockenheit aufgewachsen und alt geworden ist. „Die Leute hier haben sich viel gestritten, alle waren angespannt, weil keine der Familien genug Wasser zur Verfügung hatte." Die Reserven aus der kurzen Regenzeit im Frühjahr reichten bis Juni oder Juli, danach begann Jahr für Jahr eine harte Zeit. Zuerst trocknete der kleine Fluss aus, der die Häuser der Bauern umfließt, irgendwann dann auch der andere, zwei Kilometer entfernt, der jahrelang als Notreserve hergehalten hatte. Auf der Suche nach der raren Ressource zogen die Menschen mit ihren gelben Kanistern durch die Gegend. „Da gab es kein soziales Leben mehr, kein Miteinander", sagt Joshua Motua.
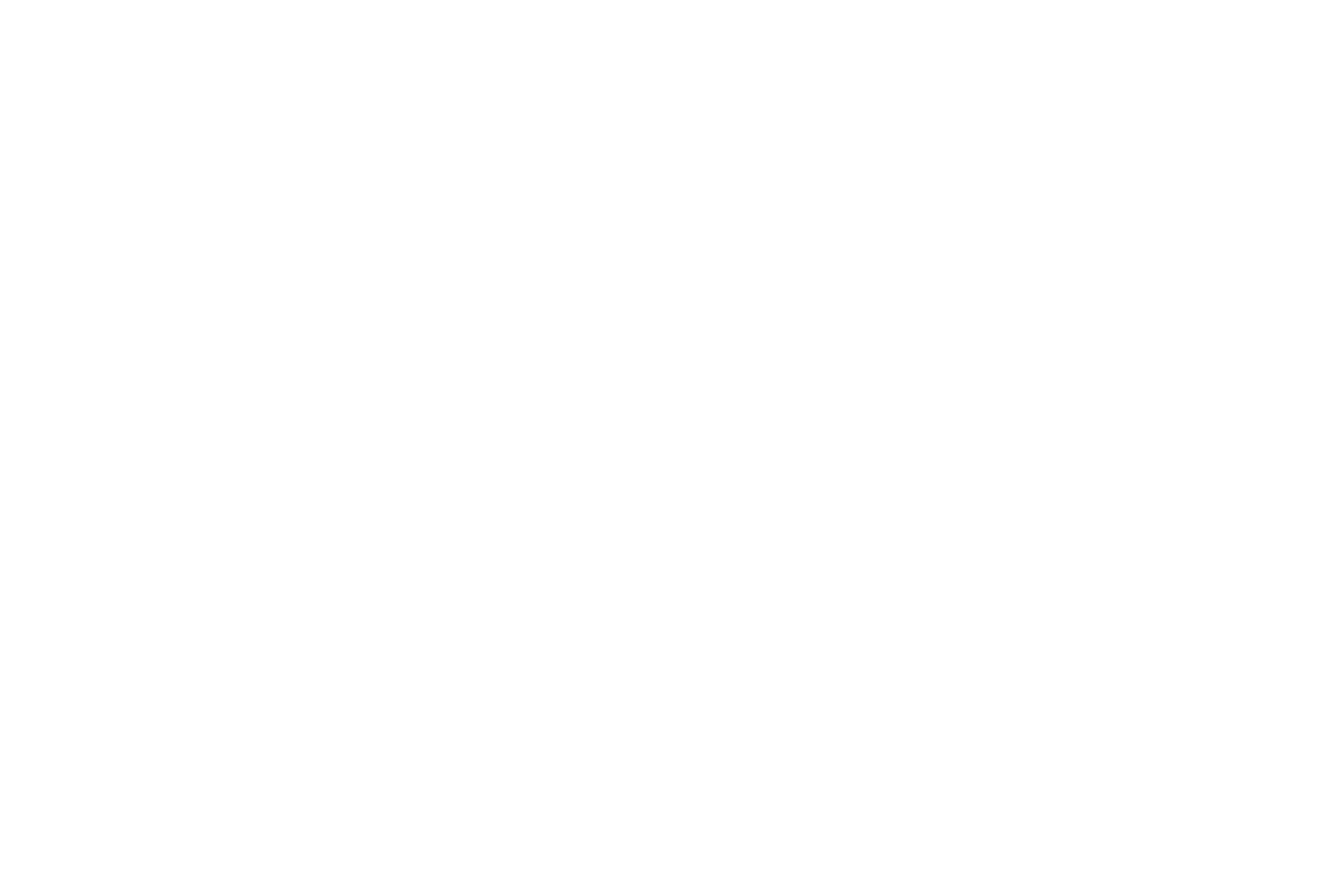 | 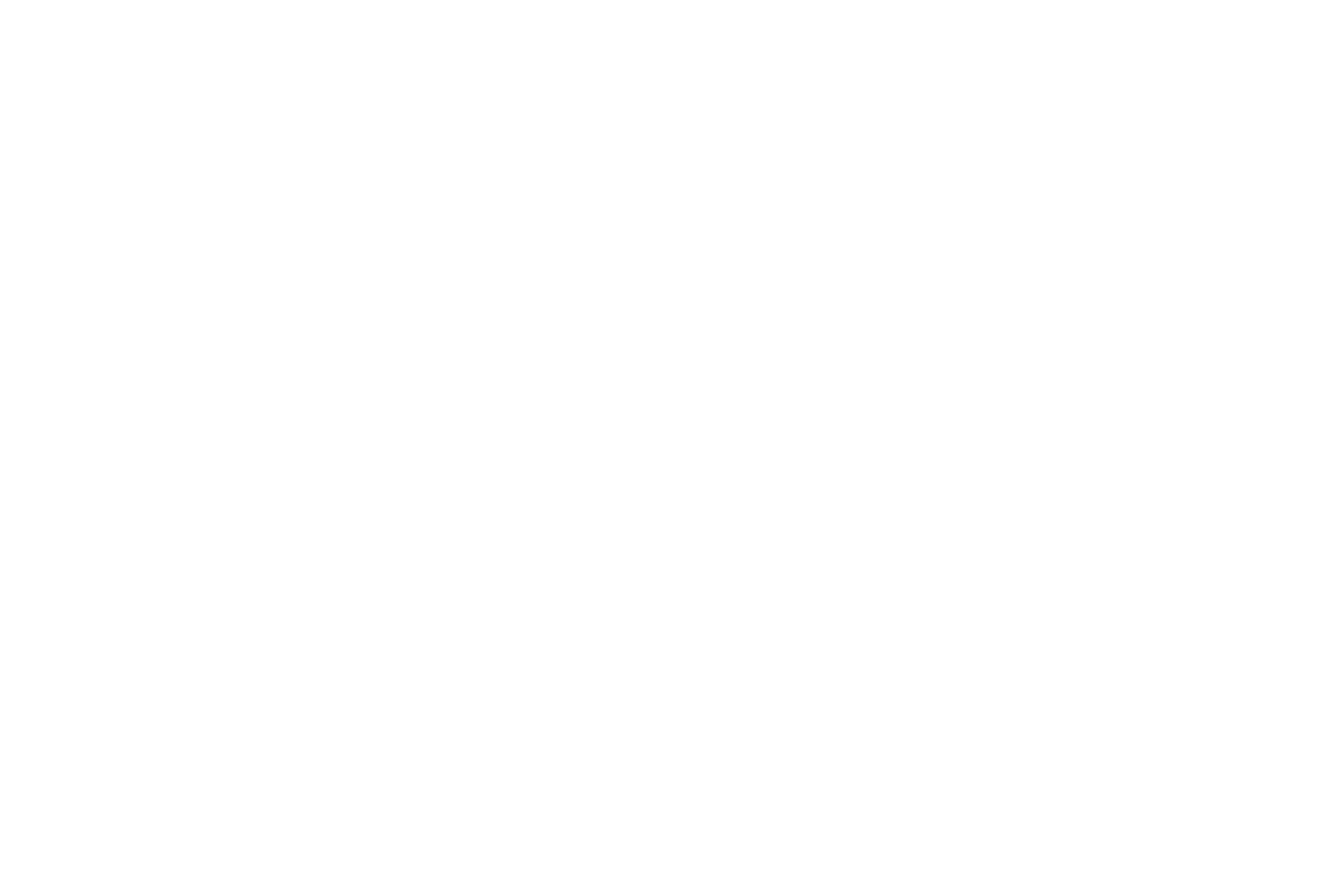 | 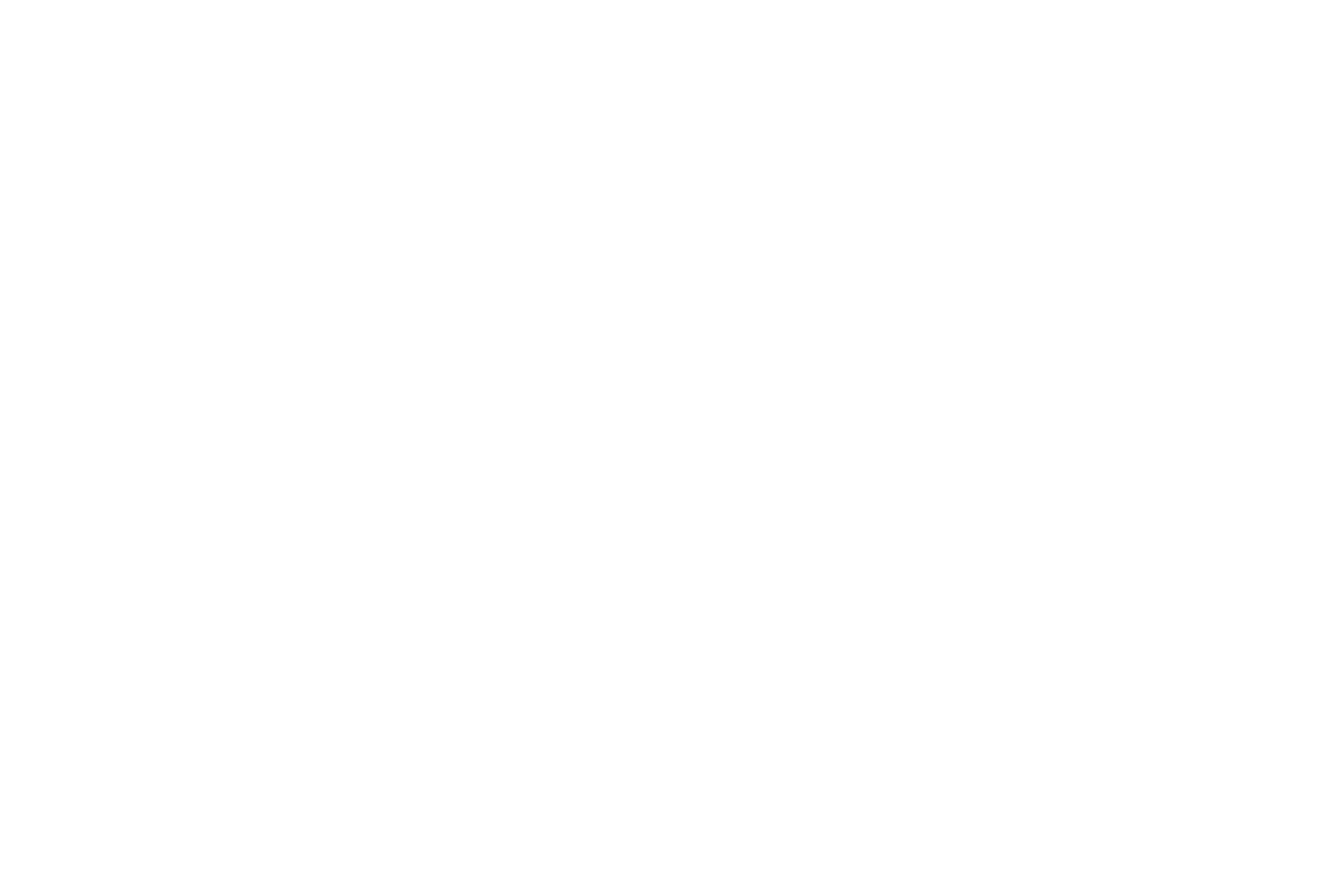 |
Jetzt, Mitte Januar 2016, überragt ihn der Mais in den unzähligen Feldern entlang des Yatta-Plateaus um eine gute Kopflänge. Und die Mangobäume ringsherum tragen so viele fette Früchte, das Gras steht so hoch, dass die Zeiten der Dürre für einen, der sie nicht erlebt hat, kaum vorstellbar sind. Hinter Motua bearbeiten drei Dutzend Männer, Frauen und Kinder, die saftig grünen Felder, zerren an Unkraut, graben Bewässerungskanäle.
Das Leben hat sich verändert in Kee, dem kleinen Dorf im County Makueni im Süden der Hauptstadt Nairobi. Das hat speziell in diesem Jahr mit El Niño zu tun, dem Klimaphänomen, von dem die Menschen hier im Radio gehört haben und das das Weltklima in diesen Monaten besonders stark durcheinanderwirbelt. In Argentinien flutet starker Regen die Straßen, Indonesien hat mit großflächigen Waldbränden zu kämpfen und allein in Äthiopien sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als zehn Millionen Menschen von einer Hungersnot bedroht.
Hier in Makueni bringt El Niño seit Wochen immer wieder ein bisschen Regen. Mehr als genug, um die Landschaften und Felder blühen zu lassen, aber auch nicht so viel wie beim letzten großen El Niño 1997, als es ganze Ernten wegspülte und totes Vieh in den Flüssen durchs Land trieb. In Makueni ist El Niño bislang mehr Segen als Fluch.
Eine uralte Idee als Mutmacher
Dass Motua und die anderen so eine Ruhe ausstrahlen, hat aber auch mit den vier Wänden aus Holz, Stacheldraht, Sand und Zement zu tun, die seit zwei Jahren im Flussbett unweit der Felder verteilt sind: Sanddämme, eine Idee, die viel älter ist als die Menschen hier, die aber gerade in Jahren ohne so viel Niederschlag die Wasserprobleme auf dem afrikanischen Kontinent mildern sollen.
Das Prinzip ist simpel: An den Dämmen soll sich der Sand, den die Fluten im Flussbett in der Regenzeit anspülen, sammeln und setzen. So entsteht mit den Jahren ein lockerer Grund, der anders als der trockene, harte Boden riesige Mengen an Wasser speichern und bis weit in die trockenen Monate hinein nutzbar machen soll – je nach Größe des Damms zwischen zwei und 20 Millionen Liter. Ein Nebeneffekt: Der Sand funktioniert als natürlicher Filter und hinterlässt sauberes Trinkwasser, zu dem die Menschen über Pumpbrunnen im Optimalfall das ganze Jahr lang Zugang haben.
Das Leben hat sich verändert in Kee, dem kleinen Dorf im County Makueni im Süden der Hauptstadt Nairobi. Das hat speziell in diesem Jahr mit El Niño zu tun, dem Klimaphänomen, von dem die Menschen hier im Radio gehört haben und das das Weltklima in diesen Monaten besonders stark durcheinanderwirbelt. In Argentinien flutet starker Regen die Straßen, Indonesien hat mit großflächigen Waldbränden zu kämpfen und allein in Äthiopien sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als zehn Millionen Menschen von einer Hungersnot bedroht.
Hier in Makueni bringt El Niño seit Wochen immer wieder ein bisschen Regen. Mehr als genug, um die Landschaften und Felder blühen zu lassen, aber auch nicht so viel wie beim letzten großen El Niño 1997, als es ganze Ernten wegspülte und totes Vieh in den Flüssen durchs Land trieb. In Makueni ist El Niño bislang mehr Segen als Fluch.
Eine uralte Idee als Mutmacher
Dass Motua und die anderen so eine Ruhe ausstrahlen, hat aber auch mit den vier Wänden aus Holz, Stacheldraht, Sand und Zement zu tun, die seit zwei Jahren im Flussbett unweit der Felder verteilt sind: Sanddämme, eine Idee, die viel älter ist als die Menschen hier, die aber gerade in Jahren ohne so viel Niederschlag die Wasserprobleme auf dem afrikanischen Kontinent mildern sollen.
Das Prinzip ist simpel: An den Dämmen soll sich der Sand, den die Fluten im Flussbett in der Regenzeit anspülen, sammeln und setzen. So entsteht mit den Jahren ein lockerer Grund, der anders als der trockene, harte Boden riesige Mengen an Wasser speichern und bis weit in die trockenen Monate hinein nutzbar machen soll – je nach Größe des Damms zwischen zwei und 20 Millionen Liter. Ein Nebeneffekt: Der Sand funktioniert als natürlicher Filter und hinterlässt sauberes Trinkwasser, zu dem die Menschen über Pumpbrunnen im Optimalfall das ganze Jahr lang Zugang haben.
Als der Boden wieder einmal trocken und in die Stimmung in der Dorfgemeinschaft mies war, erreichten Joshua Motua und seine Nachbarn Nachrichten aus einem der umliegenden Dörfer. Die Menschen dort, so hörten sie, hätten unter Anleitung einer Hilfsorganisation damit begonnen, einen Sanddamm zu errichten. Motua und die anderen, verzweifelt auf der Suche nach Wegen, ihr Wasserproblem zu lösen, schauten sich das Projekt an und trafen auf einen Mitarbeiter der „Africa Sand Dam Foundation" (ASDF), einer kleinen Organisation mit Sitz in einem heruntergekommenen Dörfchen am Highway zwischen Nairobi und Mombasa. ASDF ist eine der zahlreichen afrikanischen NGOs, die ihre Mitarbeiter in alle Ecken des Kontinents schicken, um die Menschen vom Nutzen der Sanddämme zu überzeugen.
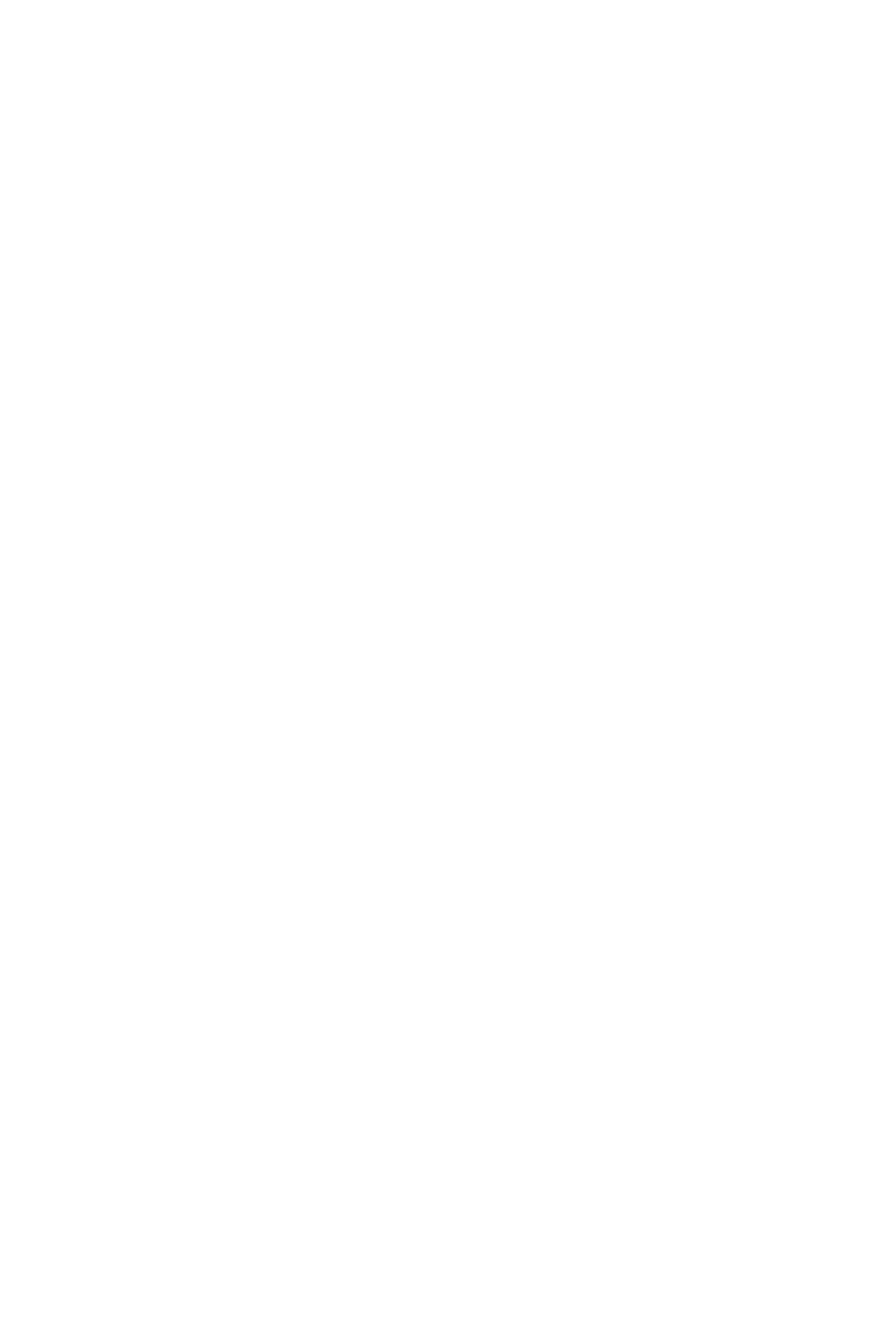
Joseph "Joe" Kioko
Die „Kee Self-Help-Group", wie Joshua Motua und die anderen Bewohner von Kee ihre Zweckgemeinschaft nennen, errichtete ihren ersten Sanddamm 2013. Drei weitere folgten. In diesem Jahr, dem El-Niño-Jahr, dürften sie so sehr wie nie zuvor von ihnen profitieren. „Es wäre fahrlässige Verschwendung, die Ressourcen, die uns die Natur gratis zur Verfügung stellt, nicht bis zum Letzten zu nutzen", sagt ASDF-Sprecher Joseph Kioko, ein schmächtiger Mann Mitte 30, den alle nur „Joe" nennen.
Grenzübergreifend auf dem Vormarsch
Mit finanzieller Unterstützung ausländischer Förderer, darunter auch die Dresdner NGO
arche noVa, hat ASDF seit der Gründung 2010 allein in Kenia knapp 230 Sanddämme errichtet und seine Arbeit mit Hilfe von Partnerorganisationen auf mittlerweile zwölf Länder ausgeweitet. „Wir sehen uns als Vermittler zwischen ausländischen Organisationen, die Zugriff auf Spenden- und Fördergelder haben, und der einheimischen Bevölkerung", sagt Kioko.
Allein in Kenia, rechnet er vor, profitierten gut 75.000 Menschen von ASDF-Projekten. Neben den Sanddämmen vermarktet die Organisation in bergigen Regionen auch „rock catchments": Mit einem Auffangsystem wird Regenwasser an Felshängen gesammelt, gereinigt und in großen Tanks gespeichert.
VIDEO: Joseph Kioko erklärt die "rock catchments".
Grenzübergreifend auf dem Vormarsch
Mit finanzieller Unterstützung ausländischer Förderer, darunter auch die Dresdner NGO
arche noVa, hat ASDF seit der Gründung 2010 allein in Kenia knapp 230 Sanddämme errichtet und seine Arbeit mit Hilfe von Partnerorganisationen auf mittlerweile zwölf Länder ausgeweitet. „Wir sehen uns als Vermittler zwischen ausländischen Organisationen, die Zugriff auf Spenden- und Fördergelder haben, und der einheimischen Bevölkerung", sagt Kioko.
Allein in Kenia, rechnet er vor, profitierten gut 75.000 Menschen von ASDF-Projekten. Neben den Sanddämmen vermarktet die Organisation in bergigen Regionen auch „rock catchments": Mit einem Auffangsystem wird Regenwasser an Felshängen gesammelt, gereinigt und in großen Tanks gespeichert.
VIDEO: Joseph Kioko erklärt die "rock catchments".
Wenn Besucher zu Gast sind, lotst Joe sie gerne zur „Kee Self-Helf-Group" um Joshua Motua. Sie ist einer der Musterschüler unter den unzähligen Gruppen, sät seit landwirtschaftlichen Schulungen spezielle gegen Dürre resistente Samen, hat Terrassen angelegt, um die Felder vor Erosion zu schützen und produziert mittlerweile so viel Gemüse, dass sie ihre Produkte über einen Großhändler aus Nairobi auch ins Ausland exportieren kann.
Das monatliche Einkommen hat sich laut Joshua Motua im vergangenen Jahr auf umgerechnet etwa 100€ pro Haushalt verdoppelt. Auf einem gemeinsamen Konto für harte Zeiten hat die Gruppe 200.000 kenianische Schilling, gut 1700€, angespart. Für die Menschen in Makueni ist das eine Menge Geld. Seit es so gut läuft, können sie alle Kinder aus der Gruppe zur Schule schicken.
Hilfe zur Selbsthilfe statt Rettung in höchster Not
So gut wie in Kee, das gibt auch Joe Kioko zu, läuft es natürlich nicht bei allen Gruppen. „Aber ohne die lokale Bevölkerung zu beteiligen und in die Verantwortung zu nehmen, wird es in Zukunft nicht gehen", sagt er. „Wenn wir jetzt nicht handeln – und das gilt für alle – wird aus der schlechten eine noch schlechtere Perspektive." Nur dann Hilfe zu schicken, wenn die Menschen bereits leiden und nicht präventiv die Ursachen der Dürren zu bekämpfen, sei ein Konzept aus vergangenen Zeiten.
Stattdessen müssten die Menschen in betroffenen Gebieten zur Selbsthilfe ausgebildet werden. Welche Samen sollten sie sähen und welche nicht? Wie lässt sich – etwa mit einem System zur Tröpfchenbewässerung – bei der Bewirtung der Felder Wasser sparen? Und: Wie lässt sich der wenige Niederschlag bestmöglich speichern? „Wir versuchen, die Art und Weise zu verändern, wie die Leute denken", sagt Kioko.
Das monatliche Einkommen hat sich laut Joshua Motua im vergangenen Jahr auf umgerechnet etwa 100€ pro Haushalt verdoppelt. Auf einem gemeinsamen Konto für harte Zeiten hat die Gruppe 200.000 kenianische Schilling, gut 1700€, angespart. Für die Menschen in Makueni ist das eine Menge Geld. Seit es so gut läuft, können sie alle Kinder aus der Gruppe zur Schule schicken.
Hilfe zur Selbsthilfe statt Rettung in höchster Not
So gut wie in Kee, das gibt auch Joe Kioko zu, läuft es natürlich nicht bei allen Gruppen. „Aber ohne die lokale Bevölkerung zu beteiligen und in die Verantwortung zu nehmen, wird es in Zukunft nicht gehen", sagt er. „Wenn wir jetzt nicht handeln – und das gilt für alle – wird aus der schlechten eine noch schlechtere Perspektive." Nur dann Hilfe zu schicken, wenn die Menschen bereits leiden und nicht präventiv die Ursachen der Dürren zu bekämpfen, sei ein Konzept aus vergangenen Zeiten.
Stattdessen müssten die Menschen in betroffenen Gebieten zur Selbsthilfe ausgebildet werden. Welche Samen sollten sie sähen und welche nicht? Wie lässt sich – etwa mit einem System zur Tröpfchenbewässerung – bei der Bewirtung der Felder Wasser sparen? Und: Wie lässt sich der wenige Niederschlag bestmöglich speichern? „Wir versuchen, die Art und Weise zu verändern, wie die Leute denken", sagt Kioko.
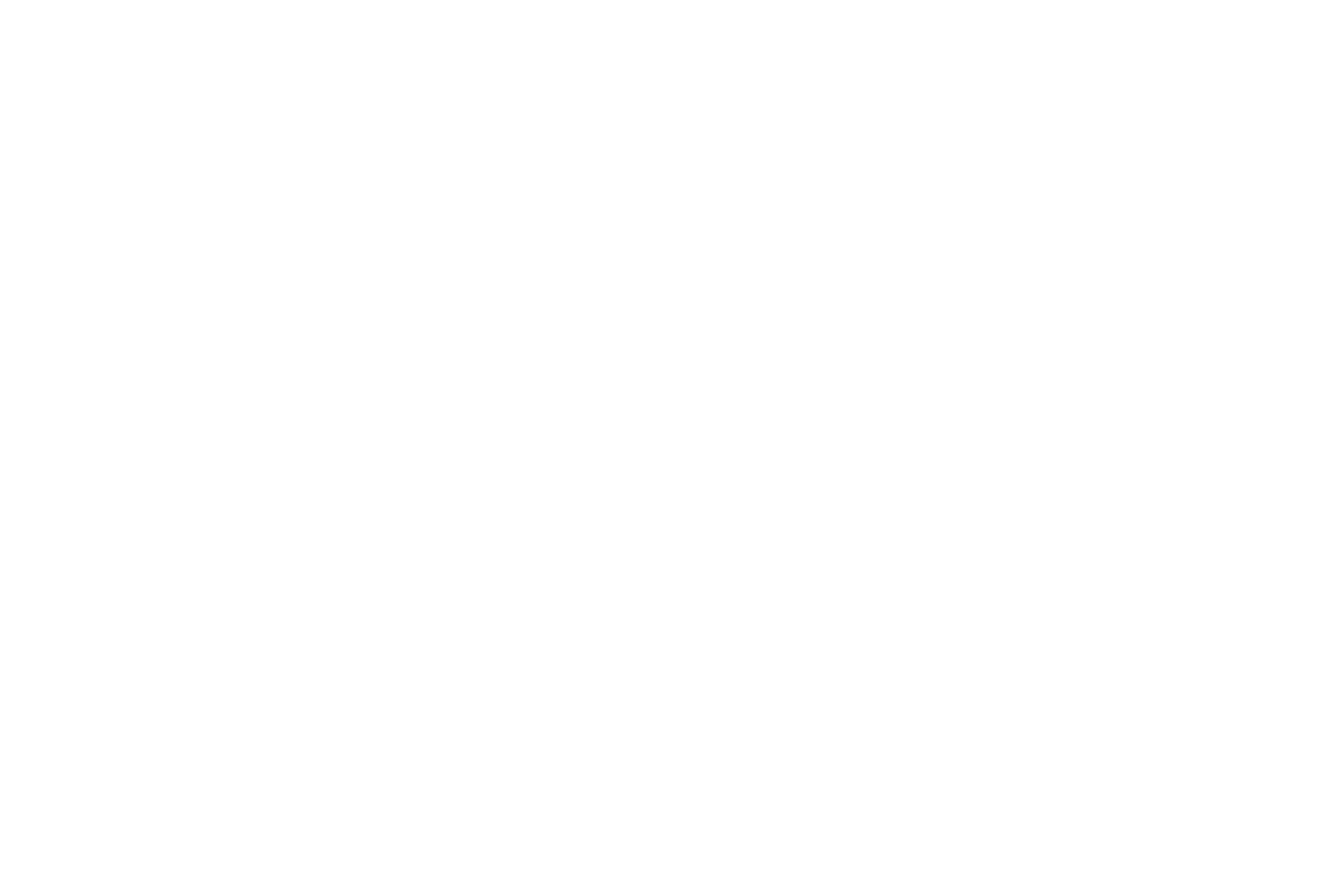 | 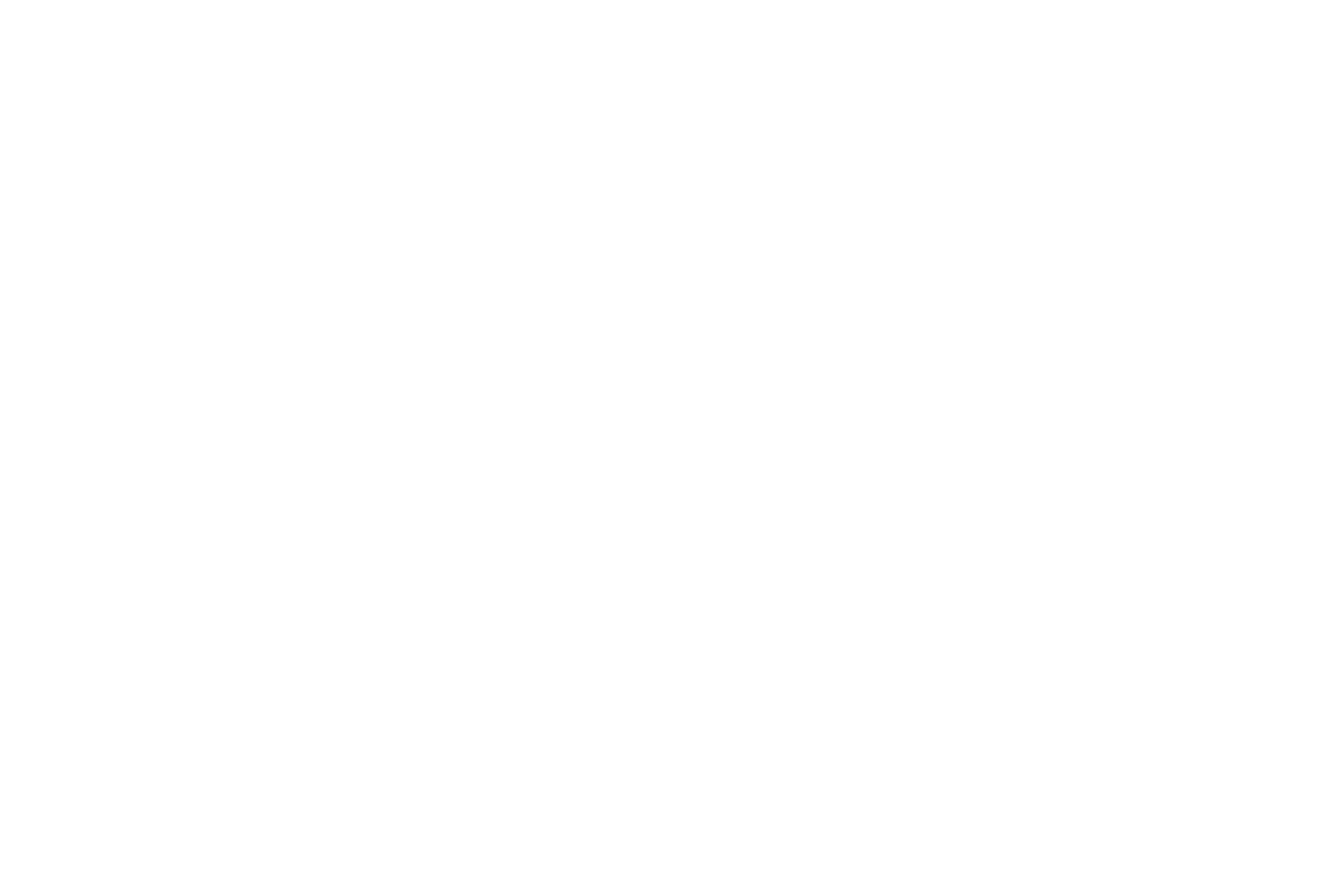 |
Die „Resilienz", ein Begriff aus der Psychologie, der die Widerstandsfähigkeit von Menschen in schwierigen Lagen beschreibt, ist in diesem Zusammenhang zu einem Modewort im Diskurs um Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit geworden. In einer Studie zur Ökonomie der Humanitären Hilfe errechneten Wissenschaftler 2012 anhand der kenianischen Wajir-Region (367.000 Bewohner), dass durch Dürrevorsorge im Katastrophenfall bis zu 167 Millionen Dollar an Hilfsgeldern eingespart werden könnten und forderte eine grundlegende Umgestaltung beim Einsatz von Spenden. Die Debatte hält bis in die Gegenwart an: Beim Welthilfegipfel im Mai in Istanbul ist der Frage nach effektiven Resilienz-Strategien eines der vier Schwerpunkt-Themen gewidmet.
ASDF setzt in diesem Zusammenhang voll auf die Zusammenarbeit mit den so genannten „Self-Helf-Groups": Nur Gruppen, die bereits gemeinschaftlich soziale Projekte – etwa die Einrichtung eines gemeinsamen Pools für Mikrokredite oder die Zusammenarbeit in Landwirtschaft oder Straßenbau – gestemmt haben und dafür vom zuständigen Ministerium zertifiziert worden sind, werden für eine Zusammenarbeit akzeptiert.
VIDEO: Doris Mulanda Wanje stellt ihre Self-Help-Group "Mbukilye ngukilye" ("Hilf' du mir und ich helfe dir") vor, eine Selbsthilfegruppe für verwitwete Frauen.
ASDF setzt in diesem Zusammenhang voll auf die Zusammenarbeit mit den so genannten „Self-Helf-Groups": Nur Gruppen, die bereits gemeinschaftlich soziale Projekte – etwa die Einrichtung eines gemeinsamen Pools für Mikrokredite oder die Zusammenarbeit in Landwirtschaft oder Straßenbau – gestemmt haben und dafür vom zuständigen Ministerium zertifiziert worden sind, werden für eine Zusammenarbeit akzeptiert.
VIDEO: Doris Mulanda Wanje stellt ihre Self-Help-Group "Mbukilye ngukilye" ("Hilf' du mir und ich helfe dir") vor, eine Selbsthilfegruppe für verwitwete Frauen.
„Das ist eine Frage der Nachhaltigkeit", erklärt Joe Kioko. „Dass sie bereits zusammen gearbeitet haben und uns um Hilfe bitten, zeigt, dass sie sich ihrer Probleme sehr genau bewusst und auch dazu in der Lage sind, sie mit unserer Unterstützung zu lösen." Dass sie dann auch die Hälfte der Baumaterialien beisteuern und den Damm oder das „rock catchment" komplett in Eigenregie errichten müssen, soll ein auf lange Sicht ein anhaltendes Gespür für Verantwortungsbewusstsein fördern. „Die Leute sollen merken, dass dieses Projekt ihr Produkt ist, ihr Eigentum."
El Niño als Chance
Durch El Niño ist 2016 ein besonderes, kein repräsentatives Jahr für Ostafrika und ein wichtiges Jahr für die NGOs, die allerorten die Sanddämme als Lösung anpreisen. Unter Anleitung von ASDF werden derzeit sechs neue Dämme gebaut, 50 weitere sind für das kommende Arbeitsjahr geplant. Der viele Regen, hofft Joe Kioko, werde den Leuten die positiven Effekte der Sanddämme besonders deutlich vor Augen führen. Schon jetzt, vor Beginn der Hauptregenzeit, trügen die Dämme genug Wasser, um die Leute locker das ganze Jahr über zu versorgen. Das könnte dazu führen, dass sich noch mehr Menschen für die Arbeit von ASDF interessieren könnten.
Zu beweisen, dass die Dämme den Menschen auf lange Sicht helfen können, ist die Aufgabe für die kommenden Jahre – wenn der Regen wieder weniger und die Dürreperioden auch in Zentralkenia wieder länger werden.
El Niño als Chance
Durch El Niño ist 2016 ein besonderes, kein repräsentatives Jahr für Ostafrika und ein wichtiges Jahr für die NGOs, die allerorten die Sanddämme als Lösung anpreisen. Unter Anleitung von ASDF werden derzeit sechs neue Dämme gebaut, 50 weitere sind für das kommende Arbeitsjahr geplant. Der viele Regen, hofft Joe Kioko, werde den Leuten die positiven Effekte der Sanddämme besonders deutlich vor Augen führen. Schon jetzt, vor Beginn der Hauptregenzeit, trügen die Dämme genug Wasser, um die Leute locker das ganze Jahr über zu versorgen. Das könnte dazu führen, dass sich noch mehr Menschen für die Arbeit von ASDF interessieren könnten.
Zu beweisen, dass die Dämme den Menschen auf lange Sicht helfen können, ist die Aufgabe für die kommenden Jahre – wenn der Regen wieder weniger und die Dürreperioden auch in Zentralkenia wieder länger werden.
Der Beitrag entstand im Rahmen des Journalistenwettbewerbs Humanitäre Hilfe der Aktion Deutschland Hilft unter Schirmherrschaft des Auswärtigen Amts.
© Jannis Carmesin 2016
© Jannis Carmesin 2016
